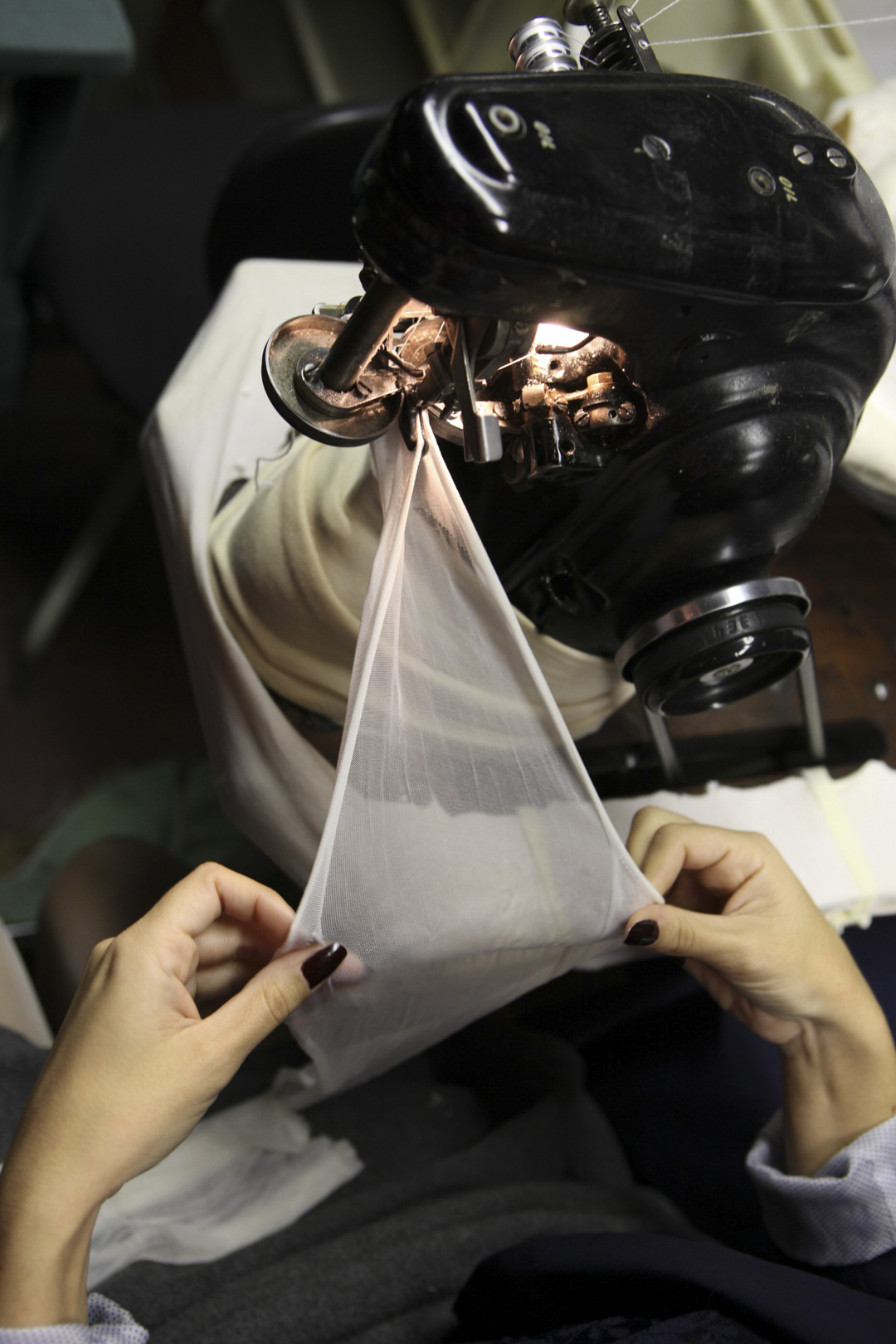Projekt in Arbeit:
Rugby im Süd-Westen Frankreichs. Volkssport und Lebenseinstellung .
Rugby, der Sport mit dem man raufende Männerhaufen und blutigen Nasen verbindet, dieser Sport soll mit Menschenliebe, Solidarität und Toleranz zu tun haben?
Auf meiner Reise durch den Südwesten Frankreichs mit der Frage im Gepäck: „Was ist Rugby? eine Religion? eine Haltung? Vergnügen oder Beruf?“, treffe ich auf verschiedene Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den ehemals Rugby-spielenden katholischen Pfarrer, sowie den Bürgermeister, den sagenumwobenen Coach Pierre Villepreux, den 80-jährigen Rugby-Coach Linn Evans, der ursprünglich aus dem Modernen Tanz kommt, aber auch die ganz normale Familie; sie alle erzählen mit einer zärtlichen Leidenschaft von ihrem Sport.
Was ist dran an der These: „au rugby on ne se croise pas, on se rencontre“, (Übersetzt: Beim Rugby kreuzt man sich nicht , man begegnet sich.)
Bei der alljährlichen mehr oder weniger katholischen Rugby Pfingst-Messe, in bzw vor der Rugby Kapelle (dessen Kirchenfenster Rugby Spieler zeigen, die Maria den Ball zuspielen und die mit Trikots dekoriert ist), finden verschiedenste Menschen zusammen, die vor allem die Liebe zum Rugby zusamemnhält.
Die „Predigt“ ähnelt eher einen zwanglosem Plausch – es wird gebetet, aber das gemeinsame Picknick im Anschluß ist der wichtigste Part der Veranstaltung. Gelebtes Miteinander in verschiedensten Farben und Formen.
(Und der Wein im Bordeaux Gebiet einfach zu gut, um etwas in der Flasche zu lassen.)
Ich werde dieses Thema aus persönlichen Interesse fortsetzten und danke an dieser Stelle denjenigen aus vollem Herzen, die mich ermutigt haben, diese Reise ins Ungewisse zu wagen.








Alles begann 1994 mit meinem Auslandssemester in Toulouse:
In einer Bar wundere ich mich über das sehr zuvorkommende Verhalten der Rugby Spieler.
Im Stade Toulousain, bei Rugbyspielen finde ich dann eine sehr familiäre und gelöste Stimmung vor: Opas sowie Enkel, dem Klichee entsprechend mit Opinel- Messern und Saucissons ausgerüstet.
Seitdem geistert die Frage durch meinen Kopf: was ist das besondere am Rugby?
Diese Frage flackert 2007 auf, als ich wieder in Toulouse bin. Ich akkreditiere mich für das Spiel Toulouse – Paris, beobachte und fotografiere.
Ich kontaktiere Yvan Roux in Hyères, ein Rugby Mythos, der inzwischen eine Kochschule gegründet hat und lasse mir sein modernes Anwesen zeigt. Wir reden vor allem über das langsame Garen bei niedriger Temperatur von Tomaten und über die Qualität von „Angel- Fischen“.
Zurück in Hamburg besuche ich einen Rugby Verein und schlage das Thema Rugby als feuilletonistisches Thema verschiedenen Magazinen vor, die allesamt abwinken.
Die Schnittmenge, die Rugby mit Kampfsportarten wie Karate, das ich 2007 begonnen habe, hat, war mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewußt.
Aber über Karate lerne ich eine interessante neue Dimension des Sports kennen: Achtung des Gegners, Respekt, Toleranz, Überwindung der Feigheit, intuitive Reaktionen und dieses ungreifbare Etwas.
Erstaunlicherweise ist die Wortwahl der Kampfkunst-Trainer fast deckungsgleich mit dem, was ich von Rugby begeisterten Priestern höre.
Der besondere Spirit beim Rugby gehört ganz selbstverständlich dazu, er wird gelebt, statt todgeredet.
Das erfahre ich hautnah, als ich im Spätsommer 2016 das Thema Rugby wieder aufgreife und es zu meinem eigenen Projekt mache.
Als „ahnungslose Deutsche“ breche ich nach ersten Internetrecherchen zum „Abenteuer Rugby“ auf, fahre in den Südwesten Frankreichs, das Rugby-Ballungsgebiet, lande in Vic-Fezensac, ein sehr kleines aber sehr lebendiges Dorf, in dem der Bürgermeister ebenfalls ein recht erfolgreicher Rugbyspieler war.
Eine ganze Wand im Rathaus zieren Regale mit gesammelten Aktenordner, in der alle Zeitungs-Artikel der lokalen Rugby Spiele von 1948 – 2004 liebevoll penibel dokumentiert sind.
Gegenüber im „Café des Sports“ komme ich am Tresen mit den Rentnern des Dorfes ins Gespräch. Man versteht zu meinen Erstaunen mein Anliegen, das in Kurzform „die Suche nach dem Rugby- Spirit“ lautet und zeigt mir nicht den erwarteten Vogel, weil ich das ausgerechnet Anfang September, also außerhalb der Spiel-Saison tue.
Ich treffe den Rugby begeisterten „Père Lasbennes“, in Nerac, der mir das Spiel aus seiner christlichen Sicht heraus beschreibt. Er vermittelt mich an den Rugby – Theoretiker Pierre Villepreux, den ich 2017 während des internationalen Workshops für Kinder in der Corèze besuche.
Dort lerne ich auch den 80 -jährigen Lynn Evans aus Oxford kennen, der aus dem modernen Tanz kommt und eine sehr eigene, freie Art der Vermittlung des Sports hat.
In den „Landes“ einem strukturschwachen Teil Frankreichs habe ich zuvor die alljährlich stattfindende katholische Pfingst- Zeremonie in der Kapelle „ Notre Dame du Rugby“ erleben dürfen.
Convivialité, das Miteinander bedeutet hier vor allem:
Gutes Essen, selbstgemachte Musik und guter Wein und natürlich Geschichten zu teilen.
Die vielen Elemente und Geschichten formen inzwischen ein Bild….
__________________________________________________
ein erhellender Artikel:
DER SPIEGEL 36/2007
Männlich, aber korrekt
Im WM-Gastgeberland Frankreich hat sich Rugby als beliebteste Sportart nach Fußball etabliert. Das knüppelharte Spiel gilt als Schule für das Leben. Besonders intensiv zelebriert wird Rugby im traditionell eigensinnigen Südwesten.
Der Mann mit dem kantigen Schädel und der Nickelbrille ist eine Art Franz Beckenbauer Frankreichs, eine Marke, ein Botschafter der Warenwelt. Er wirbt für Mobilfunkanbieter, Schinken, Champagner, die Post, eine Bäckereikette, einen Sportartikelkonzern und Rasierapparate, und wenn im Fernsehen abends die Hauptnachrichten laufen, ist Bernard Laporte fast so häufig im Bild wie sein Freund, der Staatspräsident Nicolas Sarkozy.
Laporte, 43, ist Cheftrainer der französischen Rugby-Nationalmannschaft. In acht Jahren hat er ein Team geformt, das bei der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft im eigenen Land zu den Favoriten zählt. Die „XV de France“, wie Frankreichs Rugby-Auswahl sich mit elitärem Stolz nennt, ist auf dem besten Weg, eine nationale Institution zu werden, und Laporte ist ihr Anführer. Ein moderner Napoleon.
Seine Beliebtheit verdankt Laporte seiner Biografie. Es ist die Geschichte eines Mannes, der aus einfachen Verhältnissen im ländlichen Südwesten stammt, der Vater Elektriker, die Mutter Hausfrau, und der es bis in höchste Regierungskreise geschafft hat – unmittelbar nach dem WM-Finale wird Laporte sein Amt als französischer Staatssekretär für Jugend und Sport antreten.
Laporte hat ein Buch über seinen gesellschaftlichen Aufstieg geschrieben. Es verkauft sich gut in Frankreich, und es trägt einen programmatischen Titel: „Le rugby m’a fait homme“ – Rugby hat mich zum Mann gemacht.
Für einen Deutschen mag das lächerlich klingen. Für einen Franzosen nicht. Denn anders als in Deutschland, wo hauptsächlich in Universitätsstädten wie Heidelberg, Frankfurt, Hannover oder Berlin ein paar versprengte Liebhaber dem Spiel huldigen, hat sich Rugby in Frankreich als populärste Sportart hinter dem Fußball etabliert.
Bei der Weltmeisterschaft werden mehr als zwei Millionen Menschen in die größten
Stadien des Landes strömen. 4000 Journalisten sind akkreditiert, rund drei Milliarden Menschen werden weltweit die TV-Übertragungen verfolgen. Die Deutschen werden von dem Spektakel so viel mitbekommen wie von einer regionalen Meisterschaft der Sumo-Ringer in Japan. Beim Rugby bleibt der Rhein ein Kulturgraben.
Wie beinahe überall, wo Rugby sich durchgesetzt hat – in Südafrika, Australien, Neuseeland, Ozeanien, Argentinien -, waren es Briten, die vor der Wende zum 20. Jahrhundert das Spiel nach Frankreich brachten. In die Hafenstädte am Ärmelkanal.
Zum identitätsstiftenden Sport wurde Rugby jedoch für den französischen Südwesten, speziell für das Baskenland, eine eigensinnige Region, wo die Menschen danach trachteten, sich von der Hauptstadt abzugrenzen. In Paris hatte sich der Fußball als beliebtester Ballsport durchgesetzt – nach Überzeugung vieler Rugby-Verfechter ein Vergnügen für Memmen und Komödianten.
Denn anders als beim Fußball gibt es beim Rugby so gut wie keine erschummelten Siege. Spieler, die durch Betrug oder Provokation einen Vorteil für ihre Mannschaft herausschinden wollen, werden nicht nur vom Publikum, sondern auch von den eigenen Teamkameraden geächtet.
Beim Rugby zählt nicht nur das Resultat, sondern auch die Haltung. Es geht um die Beantwortung einer uralten Frage: Wer ist der Stärkere? Es geht um den kollektiven Kampf nach klar formulierten Regeln, die zu respektieren sind. Und es geht darum, dem Gegner nach dem Kräftemessen in die Augen zu schauen und ihm die Hand zu reichen.
Dahinter steckt ein Selbstverständnis, wie es den Menschen im Südwesten Frankreichs seit Jahrhunderten entspricht. Man verteidigt sein Dorf, seine Stadt, man demonstriert seinen „esprit de clocher“, die Verbundenheit zum eigenen Kirchturm, man setzt sich für seine Nebenleute bis zur Selbstaufgabe ein. „Man kann verlieren“, sagt Philippe Guillard, der auf höchstem Niveau Rugby gespielt und ein hochgelobtes Buch über dieses Milieu geschrieben hat, „aber wenn man verliert, dann erhobenen Hauptes.“
Guillard, ein Mann mit dunklem Teint und Dreitagebart, sitzt in einem urigen Fischrestaurant am Atlantik, draußen tost das Meer. Er zählt Tugenden auf, die das Kampfspiel seiner Meinung nach erfordert: „Bescheidenheit, Mut, Gemeinsinn“. Dann fügt er hinzu: „Und Leidensfähigkeit“.
Im Rugby müssen die Akteure Schmerzen ertragen und überwinden wie in kaum einer anderen Mannschaftssportart. Es liegt in der Logik des Spiels. Der Ballführende ist in der Opferrolle. Er rennt, bis er von seinen Verfolgern zu Boden gestreckt wird oder an einem Wall aus Körpern abprallt, der sich ihm entgegenwirft. Dann passt er das Ei zurück zu seinen Kompagnons – und schafft so, begraben unter einem Berg von Leibern, den nötigen Raum für seine Mannschaft, die den Angriff verlagern und weiter nach vorn in Richtung Mallinie rücken kann.
Wie gezeichnet die Körper von den ständigen Belastungen sind, belegen die Nahaufnahmen, die einige Spieler der französischen Nationalmannschaft kurz vor der WM für die Zeitschrift „Rugby Mag“ von sich machen ließen.
So präsentiert Sylvain Marconnet seinen linken Unterschenkel, der übersät ist von Operationsnarben, als hätte er einen schlimmen Autounfall überlebt; Pierre Mignoni hält seine Hände vor die Kamera, ein Finger seiner Linken, der offensichtlich gebrochen war, ist am mittleren Gelenk schief zusammengewachsen; Lionel Nallet zeigt seinen Kopf. An seiner Ohrmuschel wuchert das Gewebe.
Bernard Marie, ein braungebrannter, breitschultriger Mann von 89 Jahren, hat alle Sorten von Verletzungen gesehen, die Rugbyspieler haben können: eingerissene Hodensäcke, lädierte Augäpfel, herausgeschlagene Zähne, zertrümmerte Unterkiefer. Der Vater der französischen Innenministerin Michèle Alliot-Marie, der selbst zehn Jahre lang Abgeordneter in der Pariser Nationalversammlung war, hat als Schiedsrichter mehr als tausend Rugby-Spiele geleitet.
Für ihn ist Rugby ein „Sport für Schurken, gespielt von Gentlemen“. Amüsiert erinnert er sich, dass ein gebrochenes Nasenbein in der Regel kein Grund zum Aufhören war: „Man hat den Knochen mit Daumen und Zeigefinger provisorisch gerichtet, das Krankenhaus konnte warten.“
Zuweilen kommt es, ohne dass der Schiedsrichter es sieht, zu wüsten Szenen wie Tritten in den Unterleib und Würgegriffen an die Kehle. Wohl am berüchtigtsten ist im Schutz des Getümmels „la fourchette“, die Gabel, wobei ein Übeltäter mit gespreizten Fingern in die Augen des Gegners fährt.
Ungesühnt bleiben derartige Regelverletzungen jedoch nicht. Nach unfairen Attacken gegen einen Mannschaftskameraden greifen Rugbyspieler zu kollektiver Selbstjustiz. Sie passen den nächstbesten Moment ab und sorgen mit chirurgischer Präzision für Gerechtigkeit. Man ist wieder quitt.
Doch mit dem Schlusspfiff endet die Gewalt. Die Spieler treffen sich nach dem Match, um gemeinsam zu essen und zu trinken, Profis gern auch im Smoking. Und die Zuschauer feiern die berühmte „troisième mi-temps“, die dritte Halbzeit. Sie trinken und singen, bis sie ermatten.
Wie berauschend diese Atmosphäre ist, hat zuletzt auch ein deutscher Spieler erfahren: Robert
Mohr, der Kapitän des Zweitligisten Stade Rochelais. Der 29-jährige Rugby-Profi aus Hannover kämpfte mit seiner Mannschaft Ende Mai gegen das Team aus Dax um den Aufstieg in die erste Liga, es war ein Entscheidungsspiel auf neutralem Terrain in Bordeaux.
La Rochelle verlor 16:22, doch die Niederlage gehört für Mohr schon jetzt zu den eindrücklichsten Momenten seiner Karriere. Denn 23 000 Menschen im Stadion bejubelten die Verlierer genauso inbrünstig wie die Sieger, die Spieler aus Dax spendeten ihren geschlagenen Rivalen anerkennenden Applaus. „Es war phänomenal“, sagt Mohr, „wie in einer besseren Welt.“
Offensichtlich hat die unmittelbare Wucht des Spiels eine kathartische Wirkung, auf Akteure wie auf Zuschauer. Anders als beim Fußball bleibt niemals das Gefühl zurück, benachteiligt oder betrogen worden zu sein. „Die Gewalt findet auf dem Spielfeld statt“, sagt Jacques Verdier, „wenn das Match vorbei ist, sind alle Rechnungen beglichen.“
Der Publizist und Literat aus Toulouse ist so etwas wie der Chef-Ideologe des Rugby in Frankreich. In seiner Heimatstadt ist Rugby die wichtigste Sportart – auch wenn der örtliche Fußballclub kürzlich erst im letzten Moment in der Qualifikation für die Champions League scheiterte.
Einmal in der Woche moderiert Verdier eine Radiosendung, die landesweit ausgestrahlt wird und die nur ein Thema hat: Rugby. Sie heißt „Viril, mais correct“, angelehnt an einen Klassiker aus dem Zitatenschatz des Rugby, den der ehemalige französische Nationalspieler Walter Spanghero einst auf die Frage nach seiner Spielweise prägte: männlich, aber korrekt.
Verdier sitzt in seinem schlichten Büro am Stadtrand, wo er die Zeitung „Midi Olympique“ aufgebaut hat. Für Kenner ist sie die „Bibel des Rugby“. Das Blatt, das zweimal in der Woche erscheint, hat eine Auflage von 80 000 Exemplaren, und mittlerweile gilt es sogar in Paris als chic, die zitronengelbe Zeitung in der Metro zu lesen. Auch Sarkozy schaut regelmäßig hinein.
Dass Rugby in der französischen Hauptstadt angekommen ist, hängt auch mit dem Unternehmer Max Guazzini zusammen. 1993 ist der Patriarch bei dem Club Stade Français eingestiegen. Er engagierte den damals noch unbekannten Bernard Laporte als Trainer und begann eine der besten Mannschaften Frankreichs aufzubauen. Der Club wurde ein großstädtisches Gegenmodell zu den Rugby-Bastionen im Baskenland.
Guazzini hält seinen Verein auch mit Marketing-Gags im Gespräch, die man im bürgerlich-konservativen Milieu des Südwestens bislang nicht kannte. So lassen sich die Spieler von Stade Français, unverhüllt und bisweilen nur mit Rugby-Ei vor dem Gemächt, für einen Kalender ablichten, der sich im ganzen Land blendend verkauft – und in Frankreichs Schwulen-Szene längst Kultobjekt ist.
Ganz ohne Nebenwirkungen bleibt die Kommerzialisierung des Rugby indes nicht. Zum einen fördert das explosionsartig gestiegene Interesse der Medien einen Starkult, wie er sich für den kollektiven Kampfsport bislang verbat. Jüngstes Beispiel: der Hype um Nationalspieler Sébastien Chabal.
Der langmähnige Hüne ist bei Trainer Laporte nur Ergänzungsspieler. Seiner Inszenierung als „Caveman“ tut die Nebenrolle jedoch keinen Abbruch. Chabal bedient perfekt das Klischee des rabiaten Höhlenmenschen – er sieht aus, als könnte er an einem schlechten Tag eine ganze Kleinstadt auslöschen.
Zum anderen verändert sich die Atmosphäre in den Stadien. Es sind nicht mehr nur Kenner, die singend die Spiele verfolgen. Auf den Tribünen sitzt jetzt auch ein Event-Publikum, das völlig losgelöst ist von der Rugby-Tradition. Beim Vorbereitungsspiel in Marseille gegen Weltmeister England war der Stimmungsumschwung neulich zu spüren. Als der englische Kapitän Phil Vickery, anscheinend schwer verletzt, vom Platz getragen wurde, pfiff ihn das Publikum erst aus, dann stimmten die Zuschauer die „Marseillaise“ an.
Wenig Sinn für Fairness zeigten Frankreichs Anhänger auch vor einem Länderspiel im Pariser Stade de France. Sie buhten die neuseeländischen Profis beim Haka aus, dem traditionellen Kriegstanz der Maori, mit dem sich die Spieler Mut machen. „Mir wird schlecht bei dem Gedanken“, schimpft der frühere Profi Guillard, „auf so viel Ignoranz müsste Stadionverbot stehen.“
Bedenken, dass das Spiel an Noblesse einbüßen könnte, halten Rugby-Kenner indes für unbegründet. Für den früheren Schiedsrichter Marie wird der Südwesten auch in Zukunft die Keimzelle seiner Sportart bleiben – erdige Dörfer und Städtchen wie Bayonne, wo die Fans aus voller Kehle schmettern: „Allez, allez, les bleus et blancs de l’Aviron Bayonnais“ – vorwärts, vorwärts, ihr Blau-Weißen von Aviron Bayonnais.
Doch original baskisch ist auch dieses Liedgut nicht mehr. Gesungen wird zu einer Melodie von Udo Jürgens – komponiert für seinen Schlager „Griechischer Wein“. MICHAEL WULZINGER
Von Michael Wulzinger
DER SPIEGEL 36/2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co.